Unser Papiergeldsystem basiert auf Schulden – wie lange funktioniert das noch?
Das heutige Geldsystem erscheint für viele selbstverständlich. Man zahlt mit Scheinen, Karten oder per Smartphone, ohne sich Gedanken über den Ursprung des Geldes zu machen. Hinter der Expansion der Geldmenge steckt ein fragiles Fundament: Schulden. Unser Papiergeldsystem – präziser gesagt: unser Fiat-Geldsystem – ermöglicht die ständige Ausweitung von Kredit. Die entscheidende Frage lautet: Wie lange kann dieses System noch funktionieren, bevor es an seine Grenzen stößt?
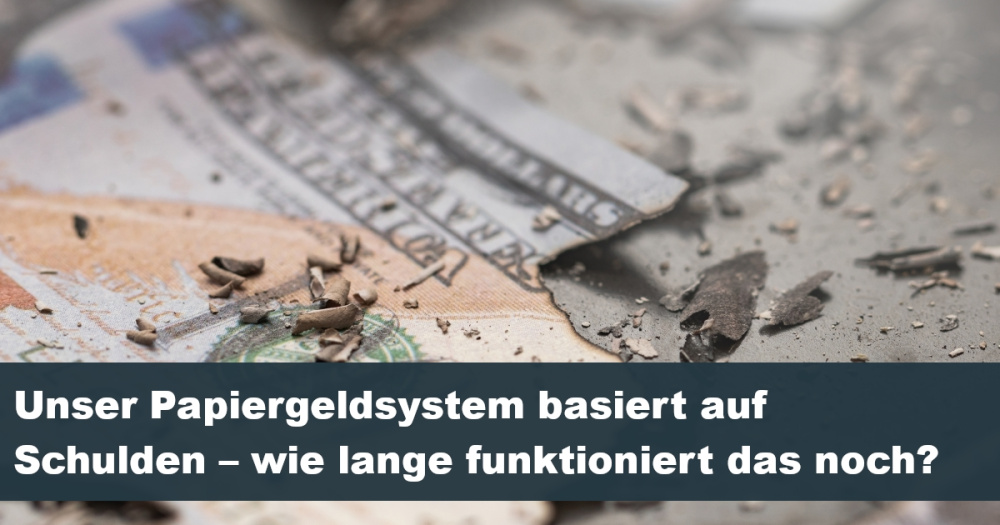
Geldschöpfung aus dem Nichts
In einem Goldstandard war die Geldmenge an physische Reserven gebunden. Heute ist das anders: Zentralbanken und Geschäftsbanken erzeugen Geld durch Kredit. Eine Bilanzverlängerung, eine Buchung – und plötzlich existiert neues „Geld“. Es handelt sich nicht um echtes Sparen, sondern um die Schaffung von Zahlungsversprechen. Jeder Euro, jeder Dollar, jede Yen auf unseren Bankkonten ist durch neue Schulden entstanden. Buchgeld ist nicht mehr gedecktes Gut, sondern Schuld des Bankensystems.
Konjunkturzyklen
Das Schaffen neuen Geldes durch die Ausgabe von neuen Krediten führt zu einer instabilen Wirtschaft. Die Österreichische Schule hat diesen Mechanismus klar beschrieben: künstlich niedrige Zinsen erzeugen Kreditorgien, Investitionen ohne echte Ersparnisse, sogenannte Fehlinvestitionen. Früher oder später kommt die Korrektur. Oft verschiebt man sie, indem man den Kreditkreislauf erneut befeuert – mit noch niedrigeren Zinsen, noch größeren Schulden, noch massiveren Rettungsprogrammen.
Autor

Prof. Dr. Philipp Bagus
Verwaltungsratspräsident
Elementum International AG
Die Grenze: Verschuldung und Inflation
Wie lange kann man Schulden auf Schulden türmen? Zwei Grenzen sind entscheidend:
- Staatliche Verschuldung: Wenn Regierungen jedes Defizit einfach durch neue Schulden finanzieren, wächst der Schuldenberg immer weiter, und mag irgendwann einmal die die Wirtschaftskraft der Volkswirtschaft übersteigen. Die Märkte beginnen zu zweifeln: Kann dieser Staat seine Anleihen jemals bedienen? Steigende Zinsen sind die Folge – oder die Notenbank springt ein und kauft die Anleihen, was zu Inflation führt.
- Inflationäre Grenze: Notenbanken können zwar prinzipiell unendlich viel neues Geld schaffen. Doch die Kaufkraft des Geldes sinkt, wenn die Menge stärker wächst als die Produktion. Die Bürger verlieren Vertrauen, fliehen in Sachwerte, Edelmetalle oder Fremdwährungen. In der Endstufe steht die Hyperinflation, wie die Geschichte von Weimar bis Venezuela zeigt.
Der politische Anreiz
Warum hält man an einem so wackligen System fest? Weil es enorme Vorteile für die politischen Eliten bietet. Schuldenfinanzierung erlaubt es, Wahlgeschenke zu verteilen, Kriege zu führen und Interessengruppen zu bedienen, ohne dass sofort sichtbare Steuererhöhungen nötig wären. Die Kosten erscheinen erst später, in Form von Inflation und wachsender Verschuldung. Der Staat lebt von der „unsichtbaren Steuer“: der Geldentwertung.
Für Banken ist das System ebenfalls lukrativ: Sie verdienen an der Kreditvergabe und profitieren im Krisenfall von Rettungsaktionen. Die Zeche zahlen Bürger und Sparer, deren Guthaben an Kaufkraft verliert.
Der Vertrauensfaktor
Papiergeld ist letztlich ein Vertrauensgut. Solange die Menschen daran glauben, dass sie morgen für ihre Scheine Waren erhalten, funktioniert das System. Doch Vertrauen kann rasch kippen. Politische Instabilität, hohe Inflation oder Bankenkrisen reichen, um Zweifel zu säen. Die Geschichte zeigt: Kein ungedecktes Papiergeldsystem hat dauerhaft Bestand gehabt. Früher oder später wurde es durch Gold, Silber oder eine Währungsreform ersetzt
Wie lange noch?
Prognosen sind schwierig. Das Schuldgeldsystem hat erstaunliche Überlebenskraft bewiesen, weil Staaten und Notenbanken über immer neue Tricks verfügen: Null- und Negativzinsen, Anleihekaufprogramme, Bankenrettungen, Eurobonds, gemeinsame EU-Schulden. Doch jedes „Rettungspaket“ verschiebt nur das Problem. Die Lasten wachsen, die Spannungen nehmen zu.
Es gibt drei denkbare Endpunkte:
- Inflationsschock: Ein massiver Vertrauensverlust führt zu Geldflucht und Preisspirale.
- Schuldenschnitt/Währungsreform: Staaten erklären ihre alten Schulden für untragbar und starten mit „neuem Geld“.
- Währungsreform beispielsweise durch eine Edelmetalldeckung: In einem Vertrauensbruch wenden sich die Menschen wieder härteren Alternativen zu, die nicht beliebig vermehrbar sind.
Flucht in Sachwerte
Für Anleger bedeutet dies: Papiergeld ist kein Hort der Sicherheit, sondern ein schleichend entwerteter Schuldschein. Wer sein Vermögen erhalten will, muss in Werte fliehen, die nicht beliebig vermehrt werden können. Gold und Silber sind seit Jahrtausenden bewährte Fluchtwährungen. Anders als Staatsanleihen tragen sie kein Ausfallrisiko, anders als Bargeld keinen Inflationsverlust. Sie sind Eigentum, kein Versprechen.
Fazit
Unser Geldsystem fördert das Prinzip „immer mehr Schulden“. Es funktioniert, solange Vertrauen herrscht und solange man die Spirale drehen kann. Doch endlos lässt sich die Logik nicht fortsetzen. Früher oder später stößt das Schuldgeld an seine Grenzen. Die Frage ist nicht, ob – sondern wann. Wer vorsorgt, indem er einen Teil seines Vermögens in echte Werte verlagert, schützt sich vor dem möglichen Fall, bei dem die Scheine nur noch bunt bedrucktes Papier sind.
Dieser Beitrag kann Links zu externen Websites Dritter enthalten. Für die Inhalte dieser externen Seiten übernimmt die Elementum Deutschland GmbH keine Verantwortung und distanziert sich ausdrücklich von allen dort bereitgestellten Inhalten. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine rechtswidrigen Inhalte erkennbar.
